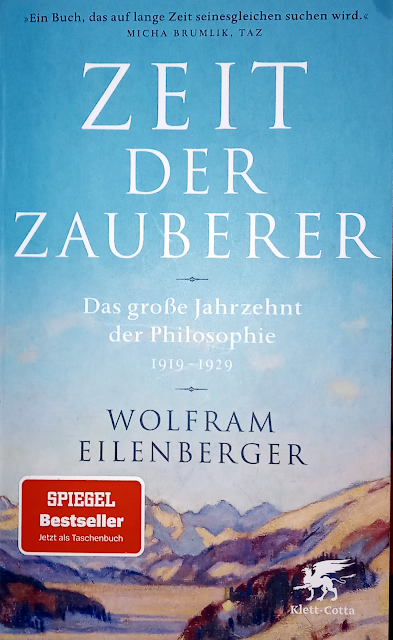THOMAS MANN: DER
ZAUBERBERG ODER WARUM WIR ALLE KRANK SIND.
https://www.youtube.com/watch?v=LC_7BthzxvU&t=507s
https://www.youtube.com/watch?v=QdNPSBYchaM&t=1s
"Der Zauberberg", ©Johann Sanssouci, Berlin, 2021.
Die Imagination darf gern weiter ausgedehnt werden: Zufälligerweise
gehen Sie dort hin, als sich ein unbekanntes und gefährliches Virus über die
ganze Welt verbreitet, Confinements, Ausgangssperre und Quarantäne
aufzwingend.
Soeben angetreten, begegnen Sie Menschen aller Art. Zum Beispiel, Joachim, einem kranken Leutnant, dem Sie die Frage stellen:
“Wahrhaftig?”, fragte Dr. Krokowski,
indem er seinem Kopf wie neckend schräg vorwärtsstieß und sein Lächeln verstärkte…
“Aber dann sind Sie eine höchst studierendswerte Erscheinung! Mir ist
nämlich ein ganz gesunder Mensch noch nicht vorgekommen”. [2]
„Aber es gibt doch die Liebe...“
Kolossaler Irrtum! Denn jetzt kommt ein Vortrag des Doktors Krokowski, „Die Liebe als krankheitsbildende Macht“, vor einem erregten Publikum, auf der Suche nach Weisheit, dem die wissenschaftlich unwiderlegbare These vorgelegt wird:
Es geht eher um eine Revitalisierung dieses Romans, als die –eventuell passende Brille für unseres „Jetzt“. Wie Thomas Mann es selbst definierte, die Wirbelsäule des „Zauberbergs“ sei, dass die Erfahrung von Krankheit und Tod das Erreichen einer reinen und hohen Gesundheit ermöglicht:
„...daß alle höhere Gesundheit durch die tiefen Erfahrungen von Krankheit und Tod hindurchgegangen sein muß, sowie die Kenntnis der Sünde eine Vorbedingung der Erlösung ist“[8].
Er ist ein sehr langer Roman, der meistens, mangels „Aktion“, in den
Köpfen und in den Seelen der Menschen vonstattengeht. Ein heutiger (postmoderner)
Verleger, dem das Typenscript auf seinem Schreibtisch landet, würde die folgende Antwort schicken:
„Geehrter Herr Thomas Mann!
Wir finden Ihren Roman sehr interessant. Es gibt genug Makabres und Erotisches um den Stoff zu verkaufen. Dennoch eine Bitte: Könnten Sie mindestens 300 Seiten des Textes einfach liquidieren?“
Mein erster Versuch mit dem opus magnum Thomas Manns liegt schon einige Jahrzehnte her, in Südamerika. Es war auf Spanisch, circa Anfang der Siebziger Jahre, und ich fand den Text „langweilig“. Dieses Adjektiv soll eher als ein Zeichen der Engstirnigkeit des jungen Mannes verstanden werden, überschwemmt von unmittelbaren politischen Diskussionen (und Ausschweifungen) des damaligen Zeitalters. Die zweite Begegnung, auf Englisch, fand in London, England statt, Anfang der 80ger Jahre, und die war nicht nur vollständig, sondern bereichernd, stimulierend. Gleichzeitig bemerkte ich, dass nur eine Konfrontation mit der deutschen Fassung all die verschleierten Strömungen, die subtilen Wortkonstruktionen innerhalb des Romans ins Licht bringen könnte. Das dritte „Wiedersehen“, oder das erste echte „Miteinander“ mit dem Original, begann in 1988. Das in Hamburg gekaufte Exemplar [9], mit all seinen Unterstreichungen, Markierungen und Zetteln, steht noch heute auf meinem Schreibtisch.
Leser und Leserinnen müssen jedoch gewarnt werden: Man wird von einer Lava überschwemmt, aus dem Vulkan eines der sprachgewaltigsten Autoren des 20. Jahrhunderts kommend. Gespickt mit Symbolen, geheimnisvollen Zeichen, chiffrierten Anspielungen und Zusammenhängen, manchmal auch linguistischen Rätseln und exquisiten semantischen Fallen, die den Lesenden vorgelegt werden. Es ist ein weites Minenfeld – aber es lohnt sich, es zu explorieren, ohne oder mit Minendetektor…
Der Bildungsroman und die erste große Lektion, die Konstellation der Liebe betreffend. Das Allerwichtigste: „zur Sache!“ Und noch dazu: „rechtzeitig!“
Bis Ende des Romans bleibt die Frage geltend, ob Hans Castorp, der in Hamburg geborene Hanseat, in der Tat vor seiner Ankunft am Sanatorium, schon in sich die Protozoen einer Krankheit trug, oder ob er selbst, seinen Geist extrem forcierend , solch eine Krankheit herbeigerufen hatte, zu allen Göttern betend, bis der Wunsch sich konkretisierte. Das ist die „echte“ Liebe: Sich erkranken zu lassen, und weiter in der Nähe des „Liebesobjektes“ zu bleiben. Dennoch: Dieses „In-der-Liebe-sein“ muss nicht bedeuten, dass man „geliebt“ wird. Jene abwesende Antwort ist, am Anfang zumindest, relativ sekundär,
Madame Chauchat - denn sie ist
verheiratet (oder so wird es kolportiert) setzt sich fast immer an den „guten
russischen Tisch“, da es auch einen „schlechten“ gibt. Daher wissen wir schon,
dass die Handlung des Romans vor der 1917 bolschewistischen Machtergreifung
stattfindet. Aber wir wissen noch nicht ob die Gäste des „guten“ Tisches die
zukünftigen Exilrussen werden sollten, und diejenigen des „schlechten“, die
Befürworter der Bolschewisten. Oder umgekehrt.
(TV 1982) Madame Chauchat (Marie-France-Pisier), nachdem sie wieder die Tür skandalös laut zumachte. „Sie ging ohne Laut, , was zu dem Lärm ihres Eintritts im wunderlichen Gegensatz stand, ging eigentümlich schleichend und etwas vorgeschobenen Kopfes zum äußersten Tische links, der senkrecht zur Verandatür stand, dem „Guten Russentisch“ nämlich, wobei sie eine Hand in der Tasche der anliegenden Wolljacke hielt, die andere aber, das Haar stützend und ordnend, zum Hinterkopf führte.“[10]
Die Liebeserklärung, die sich zwischen den Seiten 352-362 entfaltet, wird großenteils auf Französisch ausgedrückt, da der junge Hanseat es leichter fand, seinen innigsten Gefühlen in jener Fremdsprache den freien Lauf zu lassen, „c‘est parler sans parler“[11] Als Hans Castorp ihr erklärt, sein Fieber sei doch eine Konsequenz seiner totalen Hingebung zu der Dame, sagte sie:
„Quelle folie!“
„Oh, l‘amour n‘est rien s’il n‘est pas de
la folie, une chose insensée, défendue et une aventure dans le mal.“[12]
Genau vor dieser Lockung, die „aventure dans le mal“ einzugehen, wird er von einem Italiener gewarnt.
TV 1982, Hans Castorp (Christoph
Eichborn), und Madame Chauchat (Marie-France Pisier), am Abend der
Walpurgisnacht, und der „großen“ Liebeserklärung. Es dauert fast...acht Seiten!
Meistens auf Französisch, comme il faut. Man könne sich problemlos die
folgende Szene vorstellen: Die Russin hörte zu, perplex aber enthusiastisch, ihren
Kopf auf ihre linke Hand stützend : „Junge, Junge, können Sie es ein wenig
kürzer machen?“.
Es ist ein europäischer Roman, fast ohne Engländer und Engländerinnen, besser: ein „kontinental-europäischer“ Roman, der sich in der ewigen Schweiz der „Neutralität“ abspielt, und dessen eines Leitmotivs die Zukunft Europas ist.
Lassen wir uns eine allzu vorzeitige und eventuell auch riskante metaphorische Interpretation des Textes auf den Tisch legen:
Also nun, ist denn das ganze Europa „krank“? Und sei denn der Krieg die einzige „Erlösung“?
Erste amerikanische Ausgabe, 1939.
Der große Streit
Zwei extravagante und teilweise ausgeuferte Figuren verkörpern den „großen Streit“ der Ideen, und deren Verwirklichungen.
Einerseits Signor Ludovico Settembrini, ein demokratischer Republikaner, Humanist, und Freimaurer, dessen Liberalismus jedoch im großen Maße von nietzscheanischem Gedankengut geprägt und untermauert wird – manchmal sogar ungewollt, in Frage gestellt. Settembrinis maitre à penser ist der italienische Dichter Giousuè Carducci (1835-1907), Nobelpreis für Literatur in 1906, bekannt für seine, manchmal, vehementen antiklerikalischen Gedichte. Er gilt auch als ein bedeutender Literaturhistoriker und Übersetzer von Goethe und Heine ins Italienische. Settembrini tritt als ein jovialer Italiener auf, Partisan der Lebensbejahung, den Leo Naphta als einen „Zivilisationsliteraten“ abzuwerten versucht. Körperlich auf den italienischen Komponisten Ruggiero Leoncavallo (*1857-†1919 ) modelliert, wird er versuchen das „Sorgenkind“ Castorp vor den Lockungen der Krankheit und des Todes zu schützen. Er vergleicht sich selbst gerne mit Prometheus.
Mentor und Erzieher des jungen Hanseaten, warnt er auch ihn vor der „Erotikfalle“ der Madame Chauchat. Die allerwichtigste Botschaft „Krankheit als Ressentiment“ (Nietzsche), so Settembrini zu Castorp[13], ihn vor der Todessehnsucht warnend, deren Überwindung letztendlich das relevanteste und hoffnungsvollste Evangelium des „Zauberbergs“ ist.
Ganz gegenteilig Leo Naphta, ein geborener Jude, jedoch zum Katholizismus und Jesuitismus konvertiert. Naphta versucht, die hegelianisch-marxistische Dialektik - deren Kristallisierung im unvermeidbaren Klassenkampf zum Sieg des Sozialismus führen muss - mit den ur-kristlichen Fundamenten zu verschmelzen. Von Settembrini als „Princeps scholasticorum“[14] eingestuft, der ehemalig „Professor der alten Sprachen in den obersten Klassen des „Fridericianus“[15] kategorisiert selbst Georg Wilhelm Friedrich Hegel (*1780-†1831 ) als „einen katholischen Denker“[16].
Seiner Meinung nach, wird das Ankommen des Kommunismus die Grundgedanken, und Paradiesvorstellungen der ersten Aposteln des Christentums zelebrieren – und bestätigen. Die Porträtierung Naphtas ist zweifellos eine eher strapazierte Parodie des marxistischen Intellektuellen Georg Luckács (*1885-†1971), den Thomas Mann einmal traf. Der in Ungarn-geborener Philosoph schien nie davon Bescheid zu bekommen, obwohl Naphta im Roman als ein „Aftermieter Lukaçeks“[17] beschrieben wird.
„Das große Kolloquium über Gesundheit und Krankheit“[18] ist eine der relevantesten Schlachten zwischen den unversöhnbaren Kontrahenten, welches vor Hans Castorp, seinem Cousin Joachim, und anderen Teilnehmern an der „Liegekur“, durchgeführt wird.
Es geht hier um ein langes, fast-ewiges Antichambrieren (das „Chambre“, eher „la chambre“) ist die Gesellschaft, das Dasein draußen, zu Füßen des Berges, das Flachland. Dank den realen oder imaginären Krankheiten, die eine „Auszeit“ erlauben. Dieses Jenseits der Welt ermöglicht auch eine andere Art die Zeit zu zeitigen, sich in derer Samen zu vertiefen. Sie eher nicht nach dem ritualisierten Kalender bemessen zu lassen, sondern nach den Turbulenzen der Seele, den eingeborenen Veränderungen der Natur, und dem Zyklus der Krankheiten.
Nun ist die numerisch-eingeteilte Zeit aufgelöst. Die Wiederbegegnung mit der russischen Frau der „Steppenwolflichter“[22] feuert die alte Flamme wieder an, die Möglichkeit einer „Liebesnacht“ - wie vor einigen Jahren - wird raffiniert angedeutet. Aber mehr wissen wir nicht.
Die Krankheit als ein Fenster, aus dem „Sein und Zeit“ neu, vielleicht bedeutungsvoller, betrachtet und „verstanden“ werden könnten. Im zauberberghaften Sinne des Wortes, sei die Liebe als die „möglichst reinste Krankheit“ angeboten, da es einer seelischen Offenbarung entspricht, die den Opfermut nicht ausschließt. Diese reinste Krankheit kann, anfänglich, zu einer körperlichen Schwächung führen, die sogar gefährliche Grenzen berührt. Aus solch einer reinsten Krankheit soll aber auch die reinste Heilung entstehen, dank der Akzeptanz eines Prinzipiums, dank der Überzeugung, die „Liebe als Frage“ bedarf nicht immer einer Entgegnung. Es genügt, „sich-hinzuwerfen“.
Folgt die Literatur der Wirklichkeit?
Nicht zum ersten Mal, und nicht zum letzten, damals wie heute, kommen die Dichter vor den Wissenschaftlern (und Politikern) an, und triumphieren eklatant in der Voraussage. Thomas Mann setzte die richtigen Barometer ein, und alle zeigten auf Sturm.
Eines der meistgelesenen Philosophiebücher der letzten Jahrzehnte, Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie, 1919-1929, von Wolfram Eilenberger, schon in vielen Sprachen vorhanden, stellt eine pertinente Analyse von jenen Tagen in Davos, und deren Auswirkungen auf den „Weltgeist“ dar.
Wolfram Eilenberger sagt:
Postscriptum: Dem "Herrn Minister", J.S., Moabit, Berlin, sei hiermit mein Dank ausgedrückt, für die akribische Revision der deutschen Fassung, und die daraus entstandenen Gespräche.
[1]S. 18.
[2]S. 21.
[3] Seiten 102-03.
[4]S. 116.
[5]S. 121.
[6]S. 135.
[7]S. 136. Unsere Unterstreichung.
[8]Einführung in den Zauberberg Für Studenten der Universität Princeton
Als Vorwort.
[9] Mann, Thomas. Der Zauberberg, Fischer Taschenbuch Verlag, 1987,
ungekürzte Ausgabe, 768 Seiten.
[10]S. 82.
[11]S. 356.
[12]S. 361.
[13]S. 104.
[14]S. 395.
[15]S. 397. Er bezieht sich auf das 1553 gegründetes altsprachliches Gymnasium,
Schwerin. Eine der ältesten Schulen im deutschsprachigen Raum.
[16]S. 467.
[17]S.394.
[18] Seiten
473-492.
[19]S. 399.
[20] S. 577.
[21] S. 645.
[22] Seite 585.
[23]Eilenberger, Wolfram. Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der
Philosophie, Klett-Cota, 2019. Seiten 355-372.
[24]Mann, Thomas. Seiten 290-92 im Abschnitt „Forschungen“.
[25]Eilenberger, 2019, S. 370.
[26]Eilenberger, 2019, S. 25.
[27]Eilenberger, 2019, S. 376.